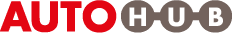Dass die Zukunft des Autos elektrisch ist, gilt mittlerweile als gesetzt. Und im urbanen Umfeld mag das auch funktionieren. Doch der Selbstversuch auf längerer Strecke wird selbst im Porsche Taycan zu einer Schnitzeljagd – nervig und alltagsfern. Dabei ist der schnelle Schwabe so ziemlich das Beste, was die deutsche Autoindustrie auf der Electric Avenue aktuell zu bieten hat.
Reichweitenangst? Wenn man die Ingenieure bei VW oder Porsche, BMW oder Mercedes auf die gängige Skepsis gegenüber den Stromern anspricht, schütteln die nur den Kopf und verbreiten Optimismus: Größere Akkus, schnellere Ladesäulen, dichtere Netze und intelligentere Software machen die Akkuautos zu alltagstauglichen Alternativen, wiederholen sie ihr Mantra und verweisen auf Reichweiten, die beim neuen EQS mit Rekordwerten von über 700 Kilometern gipfeln. In der Theorie mag das alles stimmen. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Das soll ein Selbstversuch erweisen, der ausnahmsweise mal etwas weiter führt als nur von der Wohnung zum Büro oder zum Flughafen, sondern bis hinunter auf den Balkan.
Alltag für Geschäftsleute
Von München nach Zagreb sind es rund 550 Kilometer und laut Google Maps liegt die Fahrzeit bei etwa fünf Stunden. Nicht nur zu Corona-Zeiten ist das Auto da eine sinnvolle Alternative zu Bahn oder Flugzeug. Denn für viele Geschäftsleute sind das alltägliche Distanzen, die sie mit ihren Dieseln in einem Rutsch abspulen.
Das Auto für diese Tour ist ein Porsche Taycan. Mindestens 83.520 Euro teuer, in unserem Fall 476 PS stark und 230 km/h schnell, ist er zusammen mit dem technisch eng verwandten Audi e-tron GT und demnächst dem Mercedes EQS so ziemlich das modernste und teuerste, was die deutsche Automobilindustrie dem Tesla Model S entgegen zu setzen hat. Kein anderes E-Auto aus Deutschland hat mehr Akkuleistung, und keines lädt schneller. Zumindest in der Theorie ist ein leerer Taycan bei einer Ladeleistung von 270 kW und optimalen Bedingungen in 22,5 Minuten von 5 auf 80 Prozent und in einer guten halben Stunde wieder voll. Näher können fortschrittliche Handlungsreisende ihren kilometerfressenden Standards vom Schlage einer Mercedes E-Klasse oder eines Fünfer BMW bislang nicht kommen.
Ladestopps werden geplant
Als Basismodell mit nur einem Motor ausgestattet und dafür mit dem Performance Plus Akku von netto 83,7 kWh, ist unser Testwagen der Taycan mit der größten Reichweite. Sie liegt im WLTP-Zyklus bei bis zu 484 Kilometern, doch nach ein paar flotten Kilometern am Vortag und einer kalten Nacht stellt mir der Bordcomputer vor der Abfahrt nach Kroatien bei 98 Prozent einen Aktionsradius von 338 Kilometern in Aussicht. Deshalb plant er auf dem Weg nach Zagreb im vorauseilenden Gehorsam gleich zwei Ladestopps ein. So werden aus den knapp fünf Stunden von Google schon vor dem Start mehr als sechs Stunden bis zum Ziel.
Anders als in der alten Auto-Welt erfordert diese Dienstfahrt eine gewisse Planung. Denn als der Taycan am Vortag in München einrollt, ist er von der Fahrt aus Stuttgart auf einer einsamen Autobahn ziemlich leer. Und selbst wenn unser Gastgeber eine Wallbox in der Garage hätte, würde die vom frühen Termin für den obligatorischen Corona-Test vor der Abfahrt verkürzte Nacht nicht reichen, um den großen Akku komplett zu füllen. Also geht es am Abend nochmal los zu einer halbwegs gut gelegenen Schnellladesäule – 15 Kilometer hin, 15 Kilometer zurück und 90 Minuten Laden. Und seit man am Schnellader nach spätestens vier Stunden eine Strafgebühr zahlen muss, kann man den Wagen nicht mal über Nacht stehen lassen, sondern muss ihn auf jeden Fall wieder mit heimnehmen. Wo wir einen Verbrenner in der alten Welt in fünf Minuten auf dem Weg vollgetankt hätten, verlieren wir so nun einen Großteil des Abends.
Dahingleiten statt Rasen
Aber immerhin sind wir jetzt startklar und am Vormittag geht es mit vollem Akku, negativem Test und positiver Stimmung gen Südosten – auf einer Strecke, die dem Elektroauto entgegenkommt. Denn nur auf dem kurzen Stück in Deutschland gibt es ein paar freie Abschnitte, auf denen der Taycan zumindest mal ein bisschen flotter fährt. 150, 160, ja sogar 190 km/h sind für Vielfahrer keine Raserei, sondern entspanntes Dahingleiten. Und welcher Porsche-Fahrer ist schon mit 120 Sachen zufrieden? Kaum liegt die Landesgrenze hinter uns, geht es ohnehin mit gemächlicher Geschwindigkeit und aktivem Tempomat weiter. In Österreich hat der rechte Fuß Feierabend. Viel gleichmäßiger und damit effizienter kann man ein Elektroauto kaum fahren. Kein Wunder, dass sich der Verbrauch bald in der Nähe des Normwerts von 25,4 kWh einpendelt.
Trotzdem geht der Akku in die Knie, und weil die Hypercharger längst nicht an jeder Ausfahrt, geschweige denn an jeder Raststätte stehen, bittet das Navi schon kurz nach Salzburg zum Ladestopp. Weil der besetzt ist, fahren wir weiter bis Eben im Pongau und dort lehrt uns die Elektromobilität gleich zwei weitere Lektionen: Erstens, dass eine freie Säule nichts nützt, wenn sie sich nicht freischalten lässt. Und nur, weil das Porsche-Navi sie kennt, heißt das noch lange nicht, dass dort auch die „Porsche Charging“- Karte funktioniert. Also laden wir eine App nach der anderen aufs Telefon, und melden uns so oft bei Energieversorgern an, bis endlich der passende Provider dabei ist. Nur um – zweite Lektion! – zu lernen, dass an einer 160 kW-Säule nicht einmal im Traum 160 kW fließen. Erst recht nicht, wenn nicht klar ist, welche der Säulen auf dem Parkplatz die Höchstleistung bringen soll. Schon zu Beginn des Boxenstopps liegt die Ladeleistung bei kaum 100 kW. Und je voller der Akku wird, desto weniger Strom fließt. Brachte jede Minute am Anfang noch die Energie für 7,4 Kilometer, stehen auf dem Display nach einer Viertelstunde nur noch 3,2 Kilometer/Minute – Tendenz rapide fallend. Eine Erfahrung, die sich bei jedem anderen Stopp so oder so ähnlich wiederholt. Die Lehre daraus: Wer es eilig hat, lädt lieber öfter und anders als beim Handy oder Laptop nie voll – selbst wenn man dann schon bald wieder die nächste Säule ansteuern muss. So wird aus einer Stippvisite in Kroatien eine Schnitzeljagd und die Ladelogistik zum bestimmenden Thema des Tages. Das schöne Alpen-Panorama? Der frühe Frühling in Slowenien? Die lokalen Regeln für den Lockdown? Alles verdrängt von der Frage, wann und wo wir wie lange laden sollen. Und auch die Ruhe beim Reisen und das entspannte Fahren verlieren so schnell ihren Reiz, wenn der Kopf trotzdem nicht zur Ruhe kommt.
Nette Leute
Bei den Stopps zeigt sich allerdings auch ein Vorteil der Elektromobilität: Weil Strom weniger greifbar ist als Sprit und man anders als an der Tankstelle nicht zur Kasse geht, sind die Menschen damit ungeheuer freigiebig und bisweilen tanken wir auf diesem Trip umsonst. „Ihre Karte funktioniert nicht? Nehmen sie meine“, sagt etwa der VW-Händler in Villach als würde er mal eben ein iPhone aufladen. Genau wie später am Abend der Portier des Hotels in Zagreb. Nicht vorzustellen, dass einem das auch an der Zapfsäule passieren würde. Dabei ist der „Sprit“ der Stromer alles andere als billig: An der Schnellladesäule in Villach kostet die Kilowattstunde 49 Cent, so dass wir auf etwa 30 Euro für die letzten 250 Kilometer kommen. Davon kaufen normalen Dienstwagenfahrer selbst an der überteuerten Autobahnraststätte noch ein paar belegte Brötchen zum Benzin.
Und als dauerte das Laden nicht schon lang genug, wird es im Lockdown noch ungemütlicher. Wo wir uns sonst die Zeit wenigstens mit Essen oder Einkaufen hätten vertreiben können, sitzt man sie jetzt im Auto ab. Und kann noch froh sein, wenn der Tankwart – was alles andere als selbstverständlich ist in diesen Tagen- den Zugang zu den Toiletten gewährt, während sich die Batterie füllt. Und natürlich stehen die schnellen Ladesäulen nicht irgendwo in der City, wo sich wenigstens ein Bummel anbieten würde. Sondern im besten Fall in eher nüchternen Gewerbe- oder Industriegebieten. Als allein reisende Frau würde man hier spät abends nicht mehr stehen wollen.
Glücklich ist anders
Und spät abends wird es, bis die Fahrt zu Ende ist. Denn statt nach der Google-Kalkulation um 16 Uhr oder laut Porsche-Navi nach 17 Uhr kommen wir erst um kurz vor 20 Uhr in Zagreb an. Das sind fast neun Stunden für weniger als 600 Kilometer und die Freude hält sich in engen Grenzen – denn morgen geht es zurück und die Schnitzeljagd beginnt von vorn.

Am Ende der Tour gibt es deshalb ein ausgesprochen zwiespältiges Fazit: Klar, der Taycan hat es nach Zagreb geschafft und damit bewiesen, dass Elektromobilität auch auf der Langstrecke möglich ist. Und je öfter man solche Touren unternimmt, je besser man Auto und Infrastruktur kennt und um die richtige Strategie weiß, desto leichter werden einem solche Reisen fallen. Doch zugleich beweist die Tour, dass mit der Elektromobilität etwas Entscheidendes verloren geht: Die einen mögen es hochtrabend Freiheit nennen und die anderen Flexibilität, doch einfach einsteigen und drauf los fahren, wie wir es über Jahrzehnte mit dem Verbrenner gelernt haben, das ist auf der Electric Avenue erst einmal vorbei.