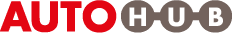Mit Farben ist es so eine Sache, wie deren unterschiedliche Einordnung durch Frau und Mann häufig deutlich macht. Neue Farben zu finden und diese dann auch noch zu Benennen war in der Branche schon immer eine Herausforderung. Vor Herausforderungen neuer Art steht die Autoindustrie aber auch beim Thema Chips. Und dies nicht etwa wegen einer zu geringen Kartoffelernte im vergangenen Jahr.
Fragt man einen Mann nach dem Unterschied zwischen Pink und Rosa, wird er sich vielleicht schwertun, einen zu erkennen. Das ist beim Schreiber dieser Zeilen nicht anders. Die Ehefrau ist da schon mal erschüttert, wie ignorant er denn sein könne und weiß noch geschätzte 125 Abstufungen zwischen Pink und Rosa zu benennen. Unser jüngst bestelltes Sitzmöbel hat offiziell die Farbe Atalanta Ceder. Das klingt doch gleich viel teurer als „Gelb“ – und ist es dann natürlich auch. Vor ähnlichen Problemen stehen immer wieder Menschen, die Lacke für Automobile taufen sollen. Schon für ein Grün, das wir als autoaffine Menschen schnell und treffend als British Racing Green einsortieren würden, gibt es inzwischen eine Vielzahl neuer Bezeichnungen und die nicht allein bei jener Marke, die diese Farbe populär gemacht hat.
Zusätzlich werden auch ständig neue Farben erfunden. Dieser Tage kam uns die Bezeichnung „Mondsteinweiß“ unter. Nun wissen wir nicht, welche Farbe so ein Stein unseres Trabanten wirklich hat, weil man so selten welche sieht. Dafür haben wir durch investigatives Lesen des englischen Originals der zugehören Pressemeldung herausgefunden, dass besagtes Mondsteinweiß eine reine Erfindung des deutschen Marketings ist. Den Damen und Herren dort schien eine wörtliche Übersetzung von „Ceramic white“ wahrscheinlich eher weniger verkaufsfördernd. Eigentlich unverständlich, verkauft doch „Villeroy und Boch“ massenhaft Produkte in eben dieser Farbe.
Apropos massenhaft. Massenhaft – also jedenfalls ganz viele – Chips arbeiten inzwischen in unseren Autos. Das ist schön, werden die Fahrzeuge im besten Fall dadurch doch smarter, erkennen Gefahren frühzeitig, vermeiden Unfälle, werden immer komfortabler und nicht zuletzt auch kommunikativer und überhaupt elektronischer.
Nun kann man zwar die eine oder andere Entwicklung in Sachen Kommunikation mit und durch das Fahrzeug aus Gründen der Ablenkung oder weil man selbst einfach ein altmodischer Boomer ist auch kritisch sehen, aber letztlich ist die Entwicklung ja nicht aufzuhalten. Für die Autoindustrie ergeben sich durch den vermehrten Einsatz von Elektronik allerdings neue, sagen mir mal Herausforderungen. Damit spielen wir ausnahmsweise nicht auf die Softwaremalaisen an, die aktuell der Deutschen liebstes Auto in seiner jüngsten Ausbaustufe gerade auskuriert. Und auch nicht auf den Rückruf von immerhin 150.000 Teslas wegen verschiedener Programmierungenauigkeiten.
Nein, es geht ganz profan um Wettbewerb. Autos konkurrieren heute wegen ihrer neuen Affinität zu elektronischen Bauteilen nicht nur untereinander, sondern auch ganz schlicht mit Fernsehern, Spielekonsolen und Handys. Und zwar um die verwendeten Halbleiter. Anscheinend gibt es weltweit nur fünf Hersteller dieser Teile, die den Bedarf industriell decken können. Als dann auf Grund der Corona-Krise einzelne Autohersteller im Frühjahr ihre Bestellungen reduzierten, weil die Prognosen nach unten gingen, um sie hinterher allerdings wieder nach oben zu korrigieren – wie man das mit Zulieferern in dieser Branche eben so macht – kann das zumindest im Elektronikbereich unschöne Folgen zeigen. Wenn dann just als die Autoindustrie ihre Bestellungen reduziert neue Spielekonsolen auf den Markt kommen, ist die Produktionskapazität schnell weg. Folge: Lange Lieferzeiten bei vielen Modellen, vor allem solchen, die mit besonders viel Elektronik punkten wollen und aktuell sogar Kurzarbeit in einigen Werken – nicht wegen Corona sondern wegen fehlender Teile.
Fehlende Teile der größeren Art bemängelten in den vergangenen Jahren auch hunderte Radfahrer im Raum Leipzig. Jedenfalls gehen wir davon aus. Denn die Leipziger Polizei hatte entsprechende Mengen gefundener und vorher wohl gestohlener Räder in ihrer Asservatenkammer. Das wäre an und für sich nicht besonders erwähnenswert, führte allerdings trotzdem zum sogenannten „Fahrradgate“ und zu einem Sonderbericht eines ebensolchen Beauftragten des Landtags.
Als treue Konsumenten allerlei Fernsehkrimis wissen wir natürlich, dass immer wieder mal beschlagnahmtes Kokain oder ähnliches Zeug von den Beamten vorsichtshalber aufopferungsvoll unter Einsatz des eigenen Körpers vernichtet wird. Manchmal wird es auch an fremde Dritte weitergegeben, um das karge Gehalt ein wenig aufzubessern. Aber das ist ja reine Fiktion. In Leipzig hat die Leiterin der Asservatenkammer dagegen die dort gelagerten Räder je nach Zustand für 25 oder 50 Euro an Kollegen verkauft. Die quittierten eine Schenkung zu Gunsten eines fiktiven Vereins und hatten flugs ein neues gebrauchtes Rad. Und die Asservatenkammer Geld in der Kaffeekasse. Letzteres wollen wir jedenfalls mal hoffen, alles andere wäre sonst ja echter Betrug und das kann bei der deutschen Polizei ja gar nicht vorkommen. Sonst noch was? Nächste Woche wieder.